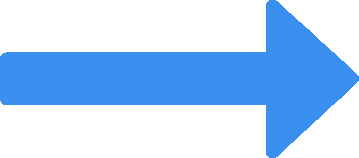Weg mit Schaden
Der Wolf war über Jahrhunderte in der Uckermark heimisch, ebenso wie Luchse und Bären. Die Menschen wussten, dass ihre Haus- und Nutztiere mit Hunden, Hirten, Schäfern und Nachtpferche geschützt werden mussten. In der Lammzeit blieben Mütter und Lämmer im Stall, mindestens bis Ende März. In manchen Uckermärkischen Dörfern sind die ehemaligen Schafställe bis heute die größten Gebäude im Ort.
Bekämpft wurde der Wolf in den Siedlungsgebieten mit mal mehr und mal weniger Erfolg. Ein königliches
Patent vom 18. August 1714 setzt Prämien für die Erlegung von Wölfen in der Neu- und Kurmark aus.
Für einen alten Wolf soll 1 Thlr., für einen jungen Wolf, auch für einen jeden, so im Lager, auf der Städte Flur oder auf dem platten Lande gefunden wird, 12 Groschen aus der Steuerkasse gezahlet werden.
Bevölkerungswachstum und technische Aufrüstung führten schließlich Ende des 19. Jahrhunderts zur kompletten Ausrottung.
In den folgenden 100 Jahren richteten sich auch in der Uckermark Landwirte und Hobbytierhalter in einer wolfsfreien Zone ein. Pferde, Schafe, Ziegen und Rinder wurden immer noch eingezäunt und aufgestallt, aber nur noch, um sie zusammen zu halten oder zur Seuchenprävention. Die Herden wuchsen zunächst, bis die Wolle aus Übersee (vor allem Australien und Neuseeland) billiger wurde. Nun wurden Schafställe umfunktioniert, der Beruf des Schäfers wurde selten. Große Herden gibt es auch heute noch, aber sie sind fast immer durch zusätzliche Aufgaben/ Einnahmen im Natur- und Deichschutz attraktiv.
Erst mit dem europaweiten Schutz durch die Berner Konvention (1979) und die spätere FFH-Richtlinie der EU änderte sich die Situation. Von der Oberlausitz aus wanderte der Wolf durchs südliche Brandenburg und Sachsen-Anhalt, an Berlin zunächst westlich vorbei nach Niedersachsen, Nordbrandenburg und damit auch in die Uckermark.
Wolf und Wandel
Schon die bloße Aussicht, bald mit Wölfen zusammenleben zu müssen, sorgte für reichlich Aufruhr in den „Wolfserwartungsgebieten“ entlang von Neiße und Oder. Dabei ging es weniger um die Aktualisierung von „Erinnerungen“ an die Zeit vor 1900, das war einfach viel zu lange her und nicht vergleichbar. Für die potentiell Betroffenen sah die Wiederansiedlung aber nach einem Städterding aus und war zudem durch Nachwendekonflikte aufgeladen: Das mit dem Wolf (und Biber) hatten sich grüne Wessis ausgedacht – die keinen Gedanken an die Opfer-Ossis verschwendeten und kein Herz für Tiere hatten (vermutlich waren das sowieso alles Vegetarier). „Brauchen wir nicht“ hörte man viel häufiger als „wir haben Angst“.

Wir hatten die erste Begegnung mit dem Wolf im April 2019. Eines frühen Morgens hörte ich das wilde Getrappel unseres Trakehner-Wallachs und stürzte auf die Koppel. Unser trächtiges Mutterschaf Gemma lag schwer verletzt im Gras. Der Tierarzt suchte und fand den typischen Kehlbiss. Ich rief beim Wolfsbeauftragten in Potsdam an, der nach Spuren fragte, die wir nicht hatten. Er würde „wegen eines einzelnen Schafes, das noch nicht mal tot war“ nicht den weiten Weg in die Uckermark fahren. Als er schlussendlich auch noch fragte, ob ich garstige Nachbarn hätte, denn die beschriebenen Verletzungen könnten doch auch von einem Schraubenzieher stammen, war ich von Socken. Ich musste irgendwas darüber schreiben, auch wenn Herr S. mir dringend abriet.
Ich versuchte mich an einem Beitrag für das politische Feuilleton des Deutschlandfunks, aber der Sendeplatz war nur 5 Minuten lang und das Thema so komplex, dass es für ein Buch gereicht hätte. Mit rotem Kopf schrieb und strich ich eine Woche lang am Text herum, denn ich wollte einerseits versichern, dass ich nicht zu den Wolfshassern gehöre, andererseits aber die Defizite einer Wolfspolitik aus Städtersicht benennen. Das konnte nicht funktionieren. Der Beitrag ging viral und wurde vielfach missverstanden.

Wenige Stunden nach dem Angriff kam Gemma nieder. Ich muss bei der Geburt der Zwillinge helfen, weil sie kaum Luft bekam. Das Bocklamm taufte ich Balduin, das weibliche Lamm Adela. Ich fütterte eine Portion Biestmilch und trennte die kleine Familie von der Herde, mit gesondertem Stall und Auslauf. Gemma fraß reichlich Hafer, nur Milch hatte sie nicht. Es sah aus, als brauche sie ihre ganze Kraft zum Atmen. Nachts wanderte ich alle zwei Stunden mit warmer Milch zum Stall.
Gemma keuchte zwar von Tag zu Tag schwerer, aber sie kuschelte mit ihren Kindern, ließ sie an ihrem leeren Euter saugen und leckte sie dabei ab. Die Lämmer wuchsen und entwickelten sich in den folgenden drei Wochen völlig normal. Sie waren zutraulich und, für Milchlämmer sonst eher untypisch, sehr vital.

Beim Ablecken geht es nicht nur um „Sauberkeit“, sondern um Bindung. Wenn ein Lamm trinkt, befindet sich der Popo auf Nasenhöhe der Mutter. So wird gecheckt: Ist es meins? Gehts ihm gut? Verdauung und Stimmung ok?
Ich war selbst überrascht, dass die Anwesenheit der Mutter für die kleinen Lämmer so wichtig war. Bis dahin hatte ich eigentlich gedacht, Ernährung sei (fast) alles. Offensichtlich gilt das, was die Bindungsforschung in den letzten Jahren bei Primaten festgestellt hat, auch für Schafe. Und eigentlich ist es ja logisch: Ohne Mutter sind die Lämmer verloren. Wem schlüge das nicht auf den Magen?


Nach drei Wochen wurde uns langsam klar, dass Gemma nicht überleben würde. Sie atmete von Tag zu Tag schwerer, fraß immer weniger, lag oft und döste vor sich hin.
An einem Tag, als genügend Helfer anwesend waren, hatte ich den Impuls, Gemma zu erlösen, aber der Anblick der Lämmer hielt mich ab. Ihnen schien das Keuchen nicht viel auszumachen, sie lehnten sich an ihre Mutter und waren zufrieden.
Am nächsten Morgen lag Gemma tot in ihrem Auslauf. Die Krähen hatten sich schon bedient, als ich sie fand.

Kümmern
Das Leben mit Milchlämmern ist immer eine aufregende Zeit. „Kümmern“ bedeutet nicht nur Sorge und Verantwortung, sondern auch Identität und Selbstwirksamkeit. Herr S. kommentierte amüsiert: Die Menge an Oxytocin und anderen Hormonen verstärkt wohl das Brutpflegebedürfnis nicht nur gegenüber den Lämmern. Sogar meine Haut veränderte sich… Das mag wie die Erzählung einer Schwangeren klingen, aber das liegt wohl eher an Zuschreibungen, als sei das Hormon-Set der Sorge und Fürsorge eine weibliche Angelegenheit. Neuere Forschungen zeigen, dass der Cocktail zwar bei Vätern und Müttern unterschiedlich zusammengesetzt ist, im Ergebnis aber die Brutpflege synchronisiert wird.
„Das Sein des Daseins ist Sorge.“
Martin Heidegger in „Sein und Zeit“ (1927)
Was Heidegger damit meint ist nicht „das Leben ist Mühsal“, sondern dass unser Leben immer schon in Verhältnissen verstrickt ist – in Fürsorge, Besorgnis, Verantwortung und Erwartung.
Eine andere Frage ist, ob das Kümmern um ein Tier vergleichbar ist mit der Sorge um ein Kind. Nein, ist es nicht. Lämmer wachsen viel schneller. Wenn der Stress bei Eltern erst richtig los geht, sind die Tierkinder schon aus dem Gröbsten raus. Das ist aber auch der einzige prinzipielle Unterschied, denn physiologisch und psychologisch gibt es nur ein Empathiezentrum in unseren Hirnen und Herzen. Hund, Katze, Kind, Lamm – es gibt keine halbe Liebe. Sorge kennt kein Maß.
Nach sechs Wochen beginnt dann die „Auswilderung“. Die Flaschenlämmer müssen einiges lernen: Was kann man fressen, was meidet man lieber, wann muss man aufschauen, wann im Takt mit den anderen Fressen, wann wiederkäuen. Naja, so genau weiß ich natürlich nicht, was alles sie lernen müssen.
Anfangs geht es noch in Begleitung in die Herde. Die anderen Mütter kommen Schnuppern; manche versuchen, die Lämmer zu stoßen – dann muss der Hirte ihnen klar machen, dass die Lämmer mütterlichen Schutz genießen. Manche Schafe erinnern sich an den Milchgeruch und versuchen, die Flasche zu erobern. Eine Woche später bleiben die Lämmer für ein paar Minuten allein in der Herde, dann eine Stunde, dann ganze Tage und schließlich auch über Nacht. Meist sind es die anderen Lämmer, die zuerst freundlichen Kontakt aufnehmen und zum Spielen auffordern. Auch später noch kommen die Flaschenlämmer zuerst angerannt, wenn man die Schafe ruft. Die ganze Herde wird zutraulicher.

oben: Adela mit vier Monaten
rechts: Balduin Ende des Sommers

Aufrüstung oder Kapitulation
Natürlich sorgten wir uns um die Herde. Die Recherche in den einschlägigen Foren und Verbreitungskarten zeigte, dass in unserem Teil der Uckermark bisher noch keine Rudel heimisch waren, sondern nur einzelne Wölfe durchzogen. Wir dichteten den Zaun und die Tore ab, so gut wir konnten und brachten oben eine zusätzliche stromführende Litze an. Aber unser Wille zur Aufrüstung hatte Grenzen. Ein neuer wolfssicherer Zaun mit 5 stromführenden Litzen kam für uns nicht in Frage: Fast 1,1km Elektro-Zaun für nur 20 Schafe war nicht förderfähig und irgendwie auch zu weit ab vom Gleichgewicht. Herr S. und ich hofften, dass Tristan auch in Zukunft als Wachpferd dienen würde, aber beim nächsten Mal, so nahmen wir uns vor, wäre Schluss mit der Schafshaltung.

Der nächste Überfall ereignete sich zwei Jahre später. Am Morgen fanden wir ein totes und ausgeweidetes Lamm auf der Weide. Die Mutter lag mit einem zerfleischten Hinterbein und zahlreichen Bisswunden in der Nähe. Sie war nicht zu retten und musste getötet werden. Die Herde drängte sich noch drei Tage in einer Ecke am Pferdestall.
Gern wollten wir unseren Beitrag zum Wolfsmonitoring leisten und meldeten den Vorfall. Diesmal kam ein Wolfsgutachter, verbrachte vier Stunden auf der Weide, bemängelte dieses, kritisierte jenes, suchte nach Spuren und bilanzierte zuletzt, er wisse nicht, was es war, „aber ein Wolf war es nicht“. Ein wilder Hund? Ein großer Fuchs? Die Zahlung einer Entschädigung käme nicht infrage, weil wir die geforderten Sicherheitsmaßnahmen gegen den Wolf (z.B. 1,20m hohe Zäune) nicht getroffen hatten. Diesen letzten Teil fand ich besonders bizarr: Was sollten uns 50 Euro helfen? Wir waren ja kein Wirtschaftsunternehmen mit hunderten Tieren, bei denen die Masse das Geschäft macht. Zwar gibt es tatsächlich auch in Brandenburg einzelne Betriebe mit 1000 und mehr Schafen, aber die durchschnittliche Herdengröße lag viel niedriger:
Laut Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (BZL): „Schafhaltung in Deutschland – ein Überblick“ (1920) halten in Deutschland insgesamt 19.870 Betriebe Schafe, davon 9.503 Betriebe , also die Hälfte, nicht mehr als 19 Schafe (kleinere Zahlen wurden nicht abgefragt).
Das sind die gemeldeten, bei der Tierseuchenkasse registrierten Schafe, die in steuerlich als Landwirtschaft oder Nebenerwerbslandwirtschaft erfassten Unternehmen gehalten werden.
Jeder auf dem Land weiß aber, dass dazu noch drei, vier, viele kleine Herden mit 3 oder 10 Schafen pro Dorf kommen, die zur Eigenversorgung gehalten und aus Bequemlichkeit, Unkenntnis oder um ein bisschen Geld zu sparen nicht gemeldet sind. Die Herdengröße in Deutschland beträgt deshalb wahrscheinlich nicht mehr als durchschnittlich 10 Tiere.
Warum wissen die Wolfsbeauftragten das nicht? Die Zahl macht den Unterschied zwischen „Stück“ und Haustieren. Oft haben die „Tiere hinter dem Haus“ Namen, gehören quasi zur Familie. Wer das Mitleiden von Schafshaltern bei Krankheiten und Tod nicht nachvollziehen kann oder sogar für bizarr hält, der halte sich die manchmal unglaublichen Aufwendungen und Ausgaben von städtischen Tierhaltern für ihre Hunde, Katzen, Kaninchen und Hamster vor Augen.
Ok… die werden nicht geschlachtet, das ist ein Unterschied. Oder nicht?
Herr S. und ich machten einen langen Spaziergang. Einerseits… andererseits… vielleicht konnten wir doch… aber müssten wir nicht? Wir wogen hin und her und konnten uns nicht entschließen, die Schafe weg zu geben. Noch einmal wurde der Zaun abgedichtet, die Litze obenauf verbessert. Ein zusätzlicher Lichtalarm am Stall sollte helfen. Zu einem dauertönenden Radiosender, den Nachbarn als (gegen den Fuchs) sehr wirksam empfohlen hatten, konnten wir uns nicht überwinden.
Rosa
2024 gab es die dritte Begegnung, diesmal unblutig: Wir hatten wieder mal ein Flaschenlamm. Rosa war von ihrer Mutter direkt am geschlossenen Tor des großen Schafsstalls abgesetzt, also geboren worden, und sehr unglücklich unter dem Tor durch auf die andere Seite gerutscht, bevor sie aufstehen konnte. Dort stand und schrie sie, während die Mutter panisch vor dem Tor hin und her rannte, ihre anderes Lamm immer wieder niedertrat und laut blökte. Ich rannte sofort hin, sah das Malheur, öffnete natürlich das Tor – und dann beging ich einen Fehler: Ich nahm das Lamm und setzte es raus. Die Mutter ignorierte es und rannte weiter vor dem Tor hin und her. Das ließ sich weder durch Anhalten noch Einreiben mit der Nachgeburt korrigieren.
Vermutlich wäre die Begegnung besser gelaufen, wenn ich die Mutter hineingelassen hätte zu ihrem Lamm. Manchmal sind es solche Details, die über den Erfolg einer Wiedervereinigung entscheiden 🙂

Jedenfalls hatte ich wieder ein Flaschenlamm. Es wohnte erst in einem Pappkarton neben dem Bett, dann im Kinderbettchen und schließlich mit einer Frühchen-Windel im Haus.
Rosa folgte mir und beschnupperte die Welt. Sie war ein außerordentlich schönes und begabtes Lamm. Sagte ich schon, dass wir die Namen in diesem Jahr dem Kreis der Sozialistischen Revolutionäre entnommen hatten?
Sie hörte gern Musik. Manchmal stand sie reglos und versonnen und schien über den Sinn des Lebens nachzudenken. Dann blickte Sie mich an und blökte leise „warum?“. Sie war ohne Zweifel frühreif und hochbegabt.
Herr S. brachte einen Witz aus der Schulverwaltung mit:
Eltern melden sich beim Direktor einer Schule und erklären ihm, dass die Verhaltensauffälligkeiten ihres Kindes Folge einer unerkannten Hochbegabung seien. Die Minderleistungen in allen Fächern seien auf extreme Unterforderung durch ahnungslose Lehrer zurück zu führen.
Der Direktor hört sich alles an, dann nickt er und sagt: „Ihr Kind ist nicht hochbegabt. Sie sind nur sehr, sehr dumm.“
Ich ahnte, dass Rosa mein letztes Flaschenlamm sein würde. Das machte diese Zeit noch einmal besonders. In der Psychologie gibt es seit Alfred Adler das „Youngest Child Syndrome“, wobei sich für meinen Geschmack das Interesse zu sehr auf die Frage richtet, wie jüngste Kinder sind und vor allem wie anders als ihre Geschwister. Weniger beleuchtet wird, dass auch die Eltern sich anders verhalten.
Weil zur gleichen Zeit ein junger Hund neu bei uns wohnte, gingen wir früh und spät Gassi: Rosa Lamm, Farlan Terrier und ich. Erstaunlicherweise wurde Rosa binnen kurzem genauso sauber wie der Hund.

Eines Morgens spazierten wir gegen halb Acht auf dem Damm zu unserer Ausflugsbank. Plötzlich stand der Wolf vor mir, keine 30m entfernt. Ich hatte gerade noch Zeit zu denken: Kenne ich den? Ein Hund aus dem Dorf ist es nicht… Es ist überhaupt kein Hund… da rannte er auch schon mit großen Sprüngen in Richtung Wald. Bevor ich das Handy aus der Tasche gefummelt und die Kamera-App gestartet hatte, war er schon in einer Senke verschwunden. Als er daraus wieder auftauchte, war er schon ziemlich weit entfernt:

Ich erzählte Nachbar T. von meiner Begegnung und er fragte: „Groß, dürr, bisschen räudig, so ein Hungerhaken?“ Genau den habe er schon mehrfach mit der Wildkamera erfasst.
Die Wolfsbeauftragte bestätigte, dass die jungen Rüden im Frühjahr oft auffällig „mausern“ und dann wie gezupft aussehen.
Wir bauten alle Elektrozäune, die wir hatten, zusätzlich zum Schafszaun auf. Regelmäßig gingen wir mit Farlan die Außengrenzen ab. Den Wolf sahen wir nicht wieder, aber diesmal waren die Würfel gefallen: Das vorerst letzte Kapitel mit den Schafen war angebrochen.
Im Herbst wurde geschlachtet wie immer. Die Mutterschafe (und Rosa natürlich) gingen an Nachbarin Barbara und nach Berkholz, der Bock zog in eine 40-köpfige Herde nach Mecklenburg. Die Wolfsbeauftragte bot uns an, einen kleineren Teil der Weide wolfsfest zu machen, aber wir nahmen uns vor, bis zum Jahresende keine Entscheidung zu treffen, sondern erstmal auszuprobieren, wie es sich ohne Schafe lebte.
der Wolf und das Schaf – Hurrrz!
Das mit dem Wolfsmonitoring scheint nicht so einfach zu sein. Einerseits muss die Entwicklung der Population beobachtet werden, wenn die Wiederansiedlung erfolgreich sein soll. Dazu müssen Zahlen von den Bundesländern geliefert werden, die ihre Erfassungsmethoden jeweils eigenständig entwickeln. Andererseits ist ein Teil der Öffentlichkeit so wolfskritisch, dass es manchen Beamten praktischer erscheint, nicht alle Erkenntnisse zu veröffentlichen.
Und manchmal ist der Wunsch Vater der Presseerklärung:
„Trotz eines Anstiegs der Wolfspopulation in Sachsen-Anhalt verzeichnen wir eine deutliche Abnahme der Nutztierrisse – ein klarer Erfolg effektiver Herdenschutzmaßnahmen“, betonte Umweltminister Jochen Willingmann in einer Pressemitteilung vom 2. Dezember 2021.
Klar und statistisch belegt ist nur , dass die Zahl der am häufigsten betroffenen Nutztiere, nämlich der Schafe, in Wolfsgebieten drastisch zurück geht weil die Halter ihre Tiere abschaffen. Nicht aus Faulheit, sondern weil sie der Verantwortung für Überleben, Wohlbefinden und Glück der Tiere nicht mehr gerecht werden können.
Und eigentlich ist der Rückgang der Hobbyschafhaltung, bei allem Bedauern, dass das Schaf doch irgendwie zur Landschaft gehört, auch in Ordnung so. Der Wolf wird gebraucht. Wo Prädatoren fehlen, fressen Rehe die Triebe junger Bäume und behindern die Erneuerung des Waldes. In Ostsachsen beispielsweise, wo viele Rudel agieren, ist die Zahl inzwischen auf ca. 2 Rehe pro Hektar gesunken. Plötzlich grünt es sogar in ausgekohlten Tagebauen. In der Uckermark dagegen gibt es mit 50 bis 60 Tieren pro 100 Hektar ein Mehrfaches. Auf der Strecke zwischen den Suckow-Kurven und Boitzenburg kann man am frühen Morgen im Herbst hunderte Tiere beobachten. Das sieht aus wie in einem Tierfilm über die Serengeti, nur ohne Zebrastreifen.
„Die Wiedereinführung der Wölfe schuf eine dreistufige trophische Kaskade: Wolf – Elch – Holzrascheltierarten wie Espen, Weiden und Baumwollholz. In Yellowstone führten daraus resultierende Verhaltensänderungen bei Elchen dazu, dass sich die Vegetation entlang der Flussufer erholt – beispielsweise erhöhte sich der Blattwerk-Bewuchs um das 2–3‑Fache in bestimmten Gebieten.“
Der Wolf jagt Waschbären nicht bevorzugt, aber er wirkt wie ein neuer Sheriff in Town: Kleine Räuber meiden offene Flächen, bewegen sich vorsichtiger, und ihr Bestand wächst langsamer. Weniger dichte Waschbär- und Marderhundbestände bedeuten Entlastung für Schildkröten und Bodenbrüter wie Kiebitze oder Uferschnepfen.
Die folgende Verbreitungskarte ist keine amtliche. Sie erfasst private Meldungen, die lt. Seitenbetreiber auf Plausibilität geprüft (aber sicher nicht gründlich faktengecheckt) werden. Ich bette sie hier ein, weil die amtlichen Karten (zum Beispiel diese hier) für Laien ziemlich unverständliche Ergebnisse zeitigen.